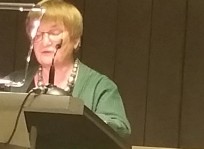20. November 2015
Otto Kohlhofer: Diskurs über Politik und Handlungsspielräume
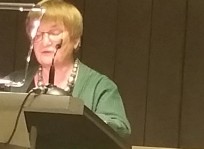
Otto Kohlhofer (1915-1988), maßgeblich an der Gründung der Gedenkstätte Dachau beteiligt, ist allen, die ihn gekannt haben, in lebhafter Erinnerung. Eines der ersten Gedächtnisblätter ist ihm gewidmet. Am 18. November 2015 referierte Barbara Distel, bis 2008 Leiterin der Gedenkstätte Dachau, auf einer Veranstaltung der Gedenkstätte über Kohlhofers Leben und Wirken.
Deutlich wurde: Otto Kohlhofers Lebensthema war die Aufklärung über den Nationalsozialismus. Als junger Kommunist verteilte er im Münchner Stadtteil Neuhausen Flugblätter, die auf das Konzentrationslager Dachau aufmerksam machten. Dies brachte ihn ins Gefängnis und schließlich ins KZ. Nach dem Krieg und nach dem KPD-Verbot 1956 resignierten viele seiner Genossen, nicht so Kohlhofer. Sein beruflicher Werdegang ist einzigartig und seinen guten Kontakten zu Alois Hundhammer (CSU) zu verdanken: Ab 1946 arbeitete Kohlhofer im Bayerischen Landwirtschaftsministerium und blieb dort bis zu seiner Pensionierung, obwohl er sich in den 50er Jahren weigerte, einen Verzicht auf „radikale Bestrebungen“ zu unterzeichnen.
Eine wesentliche Rolle spielte Otto Kohlhofer bei der Gründung der KZ-Gedenkstätte Dachau: Er handelte den Staatsvertrag für die Gedenkstätte Dachau aus, der dem Comité International de Dachau (CID) bis heute ein Mitspracherecht in allen wichtigen Belangen sichert. Nach Meinungsverschiedenheiten über das angemessene Gedenken schied Kohlhofer aus dem CID aus, der konkrete Anlass wirkt im Nachhinein eher belanglos: Er empfand einen Sektempfang des CID auf dem Gelände des Lagers als unangemessen.
Der Erinnerungspolitik blieb Kohlhofer auch später verpflichtet. Sein Engagement für eine Internationale Jugendbegegnungsstätte in Dachau ist vielen im Gedächtnis, nicht zuletzt war er häufig Gesprächspartner für die Besucherinnen und Besucher der alljährlichen Jugendbegegnungs-Zeltlager. In diesem Rahmen fanden, so Barbara Distel, die „wohl fruchtbarsten und bewegendsten Begegnungen“ zwischen Dachau-Überlebenden und jungen Leuten statt. Das Jugendgästehaus schließlich wurde erst zehn Jahre nach Kohlhofers Tod Realität.
Otto Kohlhofer wünschte sich den Diskurs über Politik und über Handlungsspielräume. Über erlittene Verletzungen wollte er nicht sprechen, damit wollte er „selber fertig werden“, so seine Aussage in einem von der Referentin zitierten lebensgeschichtlichen Interview.