Grafing: Projektpräsentationen
2025, 2023, 2022 und 2021: Präsentationen des Gedächtnisbuchs als Filme
online verfügbar
Internet
Nina Augustin, Projektteilnehmerin im Camerloher Gymnasium Freising, traf sich mit dem Sohn des von ihr porträtierten Anton Held. Hier hier Bericht:

Im Rahmen meiner Recherche über den früheren KZ Häftling Anton Held besuchte ich an einem Freitag im Januar den Sohn und dessen Frau in Petershausen. In einer sehr freundlichen Atmosphäre erzählte ich zuerst über unser Projekt „Namen statt Nummern“ am Camerloher Gymnasium und ging dabei auf unsere wöchentlichen Treffen ein. Sowohl das Erlernen der altdeutschen Schrift „Sütterlin“ als auch die Besuche in der bayerischen Staatsbibliothek und im Staatsarchiv München (siehe Berichte) sind einige Beispiel für unsere bisherige Arbeit.
Die Nachkommen des früheren Fuhrunternehmers waren sehr erfreut über das Seminar, das sich mit den Lebensgeschichten von ehemaligen KZ Häftlingen in der Umgebung, rund um Dachau, befasst und konnten mir erste Informationen über Anton Held liefern.
Ein weiterer Punkt unseres Gesprächs war meine bisherige Arbeit und die Erstellung des Rechercheberichts, der unter anderem die Bestellung von Akten in verschiedenen Archiven beinhaltet. Durch die Familie erhielt ich neue Informationen, die ich zur weiteren Arbeit nutzen werde. Eine dabei für mich einprägsame Geschichte ist die Verhaftung von Anton Held. Der Sohn erzählte mir, dass sein Vater aufgrund einer Malerei mit Straßenkreide von der SA festgenommen worden sei. Er sei als Kommunist bezeichnet worden, obwohl er früher den Sozialdemokraten nahe gestanden habe.
Zum Schluss verabschiedete ich mich von dem sehr netten Ehepaar und freue mich nun auf ein weiteres Treffen mit der Familie. Ich plane, ein genaues Interview zu führen. Private Bildquellen und andere Informationen über das Leben des früheren Sozialdemokraten werden sicher zusätzlich hilfreich sein.
(Text von Nina Augustin)
Die Ausführungen Kaya Dreesbeimdieks über Johann Kling, den ersten Nachkriegsbürgermeister von Haimhausen, beieindruckten bei der Eröffnung der Ausstellung „Das Lager und der Landkreis“ am 13. Januar 2016. Kling wurde während der NS-Zeit zweimal als politischer Gegner der Nazis verhaftet.

Die Biographie von Johann Kling schrieb die Jura-Studentin vor einigen Jahren im Rahmen des W-Seminars „Biographisches Schreiben“ als Schülerin des Josef-Effner-Gymnasiums in Dachau. Schreiben, so hatte sich Kaya Dreesbeimdiek anfangs gedacht, das klappt meist gut, biographisches Schreiben interessiert mich.
Über Kling wusste sie zunächst nur, dass er der erste Nachkriegsbürgermeister von Haimhausen war, dass er Kommunist war, Häftling des KZ Dachau, und dass es eine Tochter gab. Die erste große Herausforderung des Seminars war die Arbeit in den Archiven. Hier besonders: handschriftliche Quellen. Sie saß Stunden über den Haftbüchern und suchte nach dem Namen in einer Schrift, die schwer zu entziffern war. „Irgendwann sieht jeder Name aus wie Johann Kling!“
Um so schöner, wenn sich eine Information findet und sie eine Vermutung bestätigt. Wenn es Quellen gibt, die einen weiterbringen, die helfen, neue Ideen zum Weitersuchen zu entwickeln. Das, so glaubt Dreesbeimdiek, ist es, was jedem Historiker die Motivation gibt, weiterzumachen.
Die Referentin schilderte detailliert Johann Klings Leben. Es war geprägt von Krankheiten, aber auch von seiner Geradlinigkeit, seinem Einstehen für seine Ideale – so hat ihn jedenfalls seine Tochter im Interview geschildert.
Es gelang Kaya Dreesbeimdiek zu zeigen, wie widersprüchlich Informationen über einen Menschen in verschiedenen Quellen sein können. Beispielsweise zeigen die Dokumente aus der Entschädigungsakte, mit welchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Kling zu kämpfen hatte, als er zwischen der ersten und der zweiten Verhaftung sein Fahrradgeschäft nicht mehr weiter betreiben konnte, und zudem die Bücher seiner Leihbücherei beschlagnahmt worden waren. Er benötigte die Bücher oder einen Ersatz dafür, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, so schrieb er an das Landesentschädigungsamt. Gleichzeitig war er in Haimhausen der einzige, der ein Auto besaß. Die Zuhörer bekamen einen lebendigen Eindruck von der Vielschichtigkeit Johann Klings und gleichzeitig von den vielen offenen Fragen und Lücken, die bei der Erforschung einer Biographie entstehen.
Die Faszination und die Notwendigkeit lokaler Geschichtsforschung betonten auch die anderen Referenten des Abends. Peter Felbermeier äußerte sich in zweifacher Funktion, als Chef des Rathauses, Bürgermeister von Haimhausen und als Vorsitzender von Dachau Agil. Er zeigte sich sehr angetan vom Erfolg der Projekte der Geschichtswerkstatt und betonte mehrfach, wie froh er ist, dass es dieses Projekt gibt und dass noch so viele Zeitzeugen zu Wort kommen.

Marianne Klaffki, stellvertretende Landrätin, misst der Arbeit der Geschichtswerkstatt große Bedeutung bei. Sie trage gerade in der heutigen Zeit zu einer Gesellschaft der Menschlichkeit bei. Klaffki wünscht sich eine Fortsetzung der Arbeit der Geschichtswerkstatt.
Sabine Gerhardus, Leiterin des Teilprojekts „Das Lager und der Landkreis“ bedankte sich für die engagierte Arbeit am Projekt bei den zahlreichen Ehrenamtlichen. Sie waren es, die in mühevoller Suche und detailgetreuer Detektivarbeit die kleinen Puzzleteilchen gesucht und zu einem Bild zusammengefügt haben.
Ausstellung: Rathaus Haimhausen, Hauptstr. 15, bis 7.2.2016
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 16.00 Uhr
Do bis 18.00 Uhr
(Text: Sabine Gerhardus und Irene Stuiber, Fotos: Andreas Kreutzkam)
Mehr als Petticoat und BMW Isetta haben die 50er Jahre im Landkreis Dachau zu bieten. Die Geschichtswerkstatt startet dazu ein Forschungsprojekt und sucht Neueinsteiger. Das notwendige Handwerkszeug liefert ein kostenfreier Einführungskurs.

Als die Geschichtswerkstatt im Landkreis Dachau vor fünf Jahren begann, die Nachkriegszeit zu erforschen, hätte niemand gedacht, dass es solch ein Erfolgsprojekt werden würde: Eine Wanderausstellung, die an 16 Orten von vielen Besuchern angeschaut wurde, ein Buch mit Aufsätzen aus allen Gemeinden des Landkreises und ein reich bebildertes Ausstellungsheft sind das Ergebnis.
Nun steht das nächste Forschungsprojekt am Start: „Die 50er Jahre – Wirtschaftswunder und Verdrängung“. Am 16. Februar 2016 geht es mit einem kostenfreien Einführungslehrgang los. Ein idealer Zeitpunkt für Neueinsteiger, die sich für die Geschichte ihrer Gemeinde interessieren!
Die 50er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs. Wie erlebten Menschen im Landkreis Dachau diese Zeit? Was geschah nach dem Chaos der ersten Nachkriegsjahre? Wie gelang es den Heimatvertriebenen, in ihrem neuen Leben heimisch zu werden? Und wie veränderte sich die Arbeitswelt, als das Handwerk zurück ging und die Industriearbeit boomte? Auch im Alltag entstanden viele Neuerungen: Moderne Badezimmer ersetzten das Klohäusel, Waschmaschine und Kühlschrank gehörten ebenso zu den Errungenschaften wie Auto und Telefon. Und dann die erste Urlaubsreise nach Italien! Und die Nachkriegskinder? Sie wuchsen zu Jugendlichen heran und prägten ihre Zeit mit Petticoat, Rock n’Roll und als „Halbstarke“.
Die 50er Jahre werden als eine Erfolgsgeschichte erzählt, als Wirtschaftswunder. Doch zugleich wurde viel verdrängt. Von der nationalsozialistischen Vergangenheit wollte man nichts mehr wissen.
Die Geschichtswerkstatt möchte die 50er Jahre in all ihren Facetten und Widersprüchen erforschen. Das Team der ehrenamtlichen Forscher und Forscherinnen freut sich über jeden, der mitmacht. Vorkenntnisse braucht man nicht. Im Einführungskurs wird in zehn Unterrichtseinheiten Hintergrundwissen vermittelt: über die 50er Jahre, über Politik, über Modernisierung, aber auch über praktische Geschichtsforschung wie Interviewführung und Archivrecherche.
Sind Sie interessiert? Anmeldungen werden sehr gerne im Dachauer Forum e.V. entgegen genommen: Ludwig-Ganghofer-Str. 4, 85221 Dachau, Telefon 08131/99688-0, info@dachauer-forum.de
Mehr über die Geschichtswerkstatt erfahren Sie unter www.geschichtswerkstatt-dachau.de oder www.dachauer-forum.de.
(Text: Annegret Braun)
Die Ausstellung „Das Lager und der Landkreis“ präsentiert vom 13. Januar bis zum 7. Februar in Haimhausen Porträts von NS-Verfolgten aus dem Landkreis Dachau. Kaya Dreesbeimdiek berichtet bei der Ausstellungseröffnung am 13. Januar über Johann Kling, den ersten Nachkriegsbürgermeister.
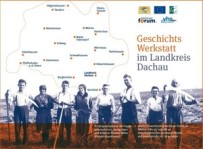
Johann Kling sei als der „Kommunist von Haimhausen“ bekannt gewesen, berichtete ein Zeitzeuge der Geschichtsforscherin. Bereits 1933 sperrten ihn die Nazis ins KZ Dachau, 1944 wurde er wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ ein zweites Mal verhaftet. Die Amerikaner ernannten ihn nach dem Krieg zum ersten Bürgermeister von Haimhausen. Kaya Dreesbeimdiek hat die Lebensgeschichte von Johann Kling erforscht und berichtet darüber bei der Ausstellungseröffnung in Haimhausen am 13. Januar 2016.
Ausstellungseröffnung: 13.1.2016, 19.30 Uhr
Ort: Rathaus Haimhausen, Hauptstr. 15
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 16.00 Uhr, Do bis 18.00 Uhr
Erst Anfang der 70er Jahre wurde das Gedenken an die homosexuellen Häftlinge der Konzentrationslager ein öffentliches Thema – bis dahin war in der Bundesrepublik selbst einvernehmliche Sexualität unter Männern strafbar. Es sollte noch ein Vierteljahrhundert dauern, bis die Erinnerung an homosexuelle Häftlinge auch in Dachau in den „Kanon des Gedenkens“ aufgenommen wurde, erläutert Albert Knoll bei der Vorstellung des von ihm herausgegebenen Buchs „Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Erinnerung an die Homosexuellen im KZ Dachau“ im Dezember im Münchner Gasthaus Deutsche Eiche.
Das Gedenken an homosexuelle Häftlinge fand in der Gedenkstätte Dachau jahrzehntelang keinen Platz. Das 1968 erbaute Internationale Mahnmal schloss die Häftlinge mit dem rosa Winkel, aber auch jene mit einem grünen oder schwarzen Winkel, explizit aus. Dem war ein entsprechender Beschluss des Comité International de Dachau (CID) vorangegangen. Lukas Schretter erforschte die Geschichte des Winkelreliefs am Mahnmal und stellt seine Ergebnisse in einem Beitrag des Buchs vor.
Albert Knoll und Burghard Richter beschreiben die weiteren Kontroversen um die Erinnerung an homosexuelle Häftlinge in Dachau: In den 70er Jahren gab es die ersten Proteste gegen die Ausgrenzung schwuler Häftlinge auf dem Gelände der Gedenkstätte. Ab Anfang der 80er Jahre nahmen Schwulenvertreter deutlich sichtbar bei den Befreiungsfeiern teil, durften jedoch offiziell keinen Kranz niederlegen. 1984 thematisierte die Ausstellung „Homosexualität und Politik seit 1900“ in der Versöhnungskirche die Verfolgungsgeschichte.
Ab Ende 1984 gab es in der zentralen österreichischen Gedenkstätte Mauthausen einen entsprechenden Gedenkstein. 1985 forderten Münchner Schwulengruppen einen Gedenktafel auch für Dachau und gaben eine entsprechende Tafel in Auftrag. Das CID und auch Bayerische Schlösser- und Seen-Verwaltung lehnten die Aufnahme dieser Tafel in den Devotionalienraum der Gedenkstätte jedoch ab, hier wolle man ein wertfreies Gedenken ermöglichen. Die Gedenktafel fand ein provisorischem Heim im Hof der Versöhnungskirche.
Ab 1990 genehmigte das CID den Schwulengruppen eine offizielle Kranzniederlegung bei der Befreiungsfeier. Im Gegenzug verzichteten die Schwulengruppen auf Transparente und Fahnen. Nicht zuletzt aufgrund des Engagement Max Mannheimers stimmte das CID schließlich 1995 dem Umzug des Gedenksteins in den Erinnerungsraum der Gedenkstätte zu.
Insgesamt erlitten 800 Rosa-Winkel-Häftlige das Konzentrationslager Dachau. Am Ende des Buches findet sich eine Namensliste mit jenen 300 Männern, die im KZ Dachau als Homosexuelle inhaftiert waren und während der NS-Zeit starben. „Ihretwegen ist das Buch geschrieben“, so Albert Knoll.
Albert Knoll (Hg.) Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Erinnerung an die Homosexuellen im KZ Dachau.
Das Buch kann online zum Preis von 7 Euro zzgl. Versandkosten über das Forum Homosexualität München info@forummuenchen.org bestellt werden. Verkauft wird es außerdem im CID-Buchladen an der KZ-Gedenkstätte Dachau und demnächst im Sub-Schwulenzentrum, Müllerstr. 14.
Emma, Teilnehmerin des W-Seminars am Camerloher Gymnasium in Freising, berichtet über einen Besuch im Stadtarchiv Freising.

Ende November besuchten wir, eine kleine Gruppe von Schülerinnen und einem Schüler der elften Klasse, das Stadtarchiv Freising, um uns dort eine Einführung in den Bestand und die Arbeitsmöglichkeiten geben zu lassen. Für das Schreiben unserer Häftlingsbiographien ist die Arbeit in Archiven sehr wichtig, sei es nun im Münchner Staatsarchiv, das wir einige Wochen davor besichtigt hatten, oder bei uns im kleinen beschaulichen kommunalen Archiv.
Zumindest der Lesesaal, in dem wir kurz begrüßt wurden, war klein und beschaulich, aber das Magazin im Keller, in das uns der Leiter des Stadtarchivs, Florian Notter, führte, war wieder gewohnt archivmäßig groß und beeindruckend und beherbergte interessante Dinge. Zum Beispiel Jahresberichte des Camerloher aus den 1990ern, in dem sich viele lustige alte Fotos von unseren jetzigen Lehrern fanden, unglaublich alte Urkunden, die auf Pergament geschrieben waren, und natürlich auch Quellen, die relevant für unsere Projekte waren, z.B. Unterlagen zur Einbürgerung im 19./20. Jahrhundert und Familienmeldebögen.
Die Seminarteilnehmer freuen sich auf weitere Zusammenarbeit mit dem Freisinger Stadtarchiv und bedanken sich für die schöne Einführung!
Karolin, Teilnehmerin im W-Seminar am Camerloher Gymnasium in Freising, berichtet über die Exkursion des Seminars ins Münchner Staatsarchiv.

Am 10. November 2015 besuchte das gesamte Seminar das Staatsarchiv München. Robert Bierschneider, Archivar am Staatsarchiv, der die Schüler weiterhin betreuen und bei ihrer Arbeit unterstützen wird, führte die Seminarteilnehmer detailliert in die Funktionen eines Archivs ein.
Robert Bierschneider erklärte, an welche verschiedenen Archive man sich für konkrete Informationen über einen ehemaligen Häftling wenden muss. Bei einer Führung in die wichtigsten Räume des Archivs erklärte der Archivar, wie die Schüler Akten und Dokumente richtig anfordern und mit ihnen arbeiten können.
Der Besuch im Staatsarchiv liegt schon einige Wochen zurück. Seitdem hatten einige der Schüler bereits die Gelegenheit, ein Einzelgespräch mit Robert Bierschneider zu führen, wobei konkret auf die Fragestellung des einzelnen Seminarteilnehmers eingegangen wurde.
Die Projektarbeiten im W-Seminar am Freisinger Camerloher Gymnasium sind verteilt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars befassen sich mit Personen, die im KZ Dachau inhaftiert waren.

Schwerpunkt des Seminars sind Verfolgtenbiographien mit einem Bezug zum Landkreis Freising. Das Spektrum ist weit: Es reicht von Personen aus der Arbeiterbewegung (KPD, SPD) über Geistliche bis hin zur Verfolgung aus sozialen Gründen (sog. asoziale Häftlinge), die Lebensbeschichten einiger jüdischer Verfolgter werden thematisiert und auch die Verfolgung aufgrund von Homosexualität.
Über folgende Personen recherchieren die Schülerinnen und Schüler: Anton Held, Korbinian Geisenhofer, Albert Eise, Peter Granninger, Ferdinand Zwack, Johann Unterleitner, Josef Altmann, Ludwig Mayer, Georg Ziegltrum, Max Kirchlechner, Oskar Holzer, Siegfried Neuburger, Max Moses und Thomas Gross.
Nicht mit dem Landkreis Freising verbunden ist die Lebensgeschichte des Film- und Theaterregisseurs und Drehbuchautors Karl Fruchtmann, über dessen Biographie eine Schülerin arbeitet. Fruchtmann stammte aus einer jüdischen Familie, er erlitt die KZ-Haft in Sachsenburg und Dachau. Er emigrierte nach Palästina, kehrte 1958 nach Deutschland zurück und machte sich mit Filmen und Theateraufführungen einen Namen.
Wir wünschen den Freisinger Schülerinnen und Schüler viel Erfolg bei der Recherche!