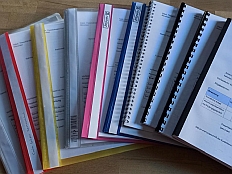12. November 2025
Spuren suchen – Berichte aus dem Treuchtlinger W-Seminar
Khrystyna Maksymljuk, ASF-Freiwillige im Gedächtnisbuch, berichtet für uns über das W-Seminar am Gymnasium der Senefelder-Gesamtschule, Treuchtlingen. Hier ihre Berichte über die beiden letzten Workshops.

Am 21. Oktober 2025 setzte das W-Seminar am Gymnasium der Senefelder-Gesamtschule in Treuchtlingen seine Arbeit im Rahmen des Projekts „Namen statt Nummern“ fort. Die Projektleiterin des Gedächtnisbuchs, Sabine Gerhardus, war zu Gast und besprach mit den Schülerinnen und Schülern den Zeitplan sowie die nächsten Schritte in der Forschungsarbeit.
Gemeinsam ging die Gruppe der Frage nach, was es bedeutet, Spuren eines Lebens zu suchen. In einer lebhaften Diskussion wurden Fragen gestellt wie: „Wie findet man Hinweise auf das Leben einer Person?“, „Welche Details können auf jemanden hinweisen?“ oder „Wo lassen sich heute noch Dokumente entdecken?“ Dabei zeigte sich, dass historische Forschung oft mit kleinen Details beginnt – einer alten Adresse, einem Eintrag in einem Register oder einem vergilbten Foto –, die den Zugang zu einer ganzen Lebensgeschichte eröffnen können.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Bedeutung des historischen Kontexts. Die Schülerinnen und Schüler erkannten, dass Fakten allein nicht genügen: Jede Biografie muss in die politischen, gesellschaftlichen und menschlichen Umstände der damaligen Zeit eingebettet werden. Nur so kann das Erinnern den Menschen gerecht werden, deren Spuren sie heute erforschen.
So geht das Seminar mit neuem Wissen und Motivation weiter. Jede und jeder Teilnehmende schlüpft in die Rolle eines Historikers oder einer Historikerin, fügt Puzzleteile zusammen und gibt vergessenen Menschen wieder eine Stimme.
Geschichte verstehen – Das W-Seminar erforscht historische Methoden

Am 11. November 2025 machte das W-Seminar am Gymnasium der Senefelder-Gesamtschule in Treuchtlingen weiter im Projekt „Namen statt Nummern“. Sabine Gerhardus sprach mit den Schülerinnen und Schülern über die nächsten Schritte ihrer Forschungsarbeit. Im Mittelpunkt stand diesmal die Bedeutung, den historischen Hintergrund jener Zeit zu verstehen – die gesellschaftlichen, politischen und behördlichen Strukturen, die das Leben der Menschen im Nationalsozialismus prägten.
Sabine Gerhardus regte die Teilnehmenden an, Hypothesen zu entwickeln und Ideen zu sammeln, wie sich Spuren zu den zu erforschenden Personen finden lassen.
Ein zentrales Thema war das Provenienzprinzip: Also die Frage, bei welcher Behörde ein Vorgang aktenkundig geworden sein könnte und auf welcher Verwaltungsebene. Gemeinsam überlegten die Schülerinnen und Schüler, ob Dokumente auf kommunaler, regionaler oder staatlicher Ebene entstanden sein könnten. Dieses Verständnis hilft ihnen, historische Quellen besser einzuordnen und die Entstehung von Akten nachzuvollziehen.
Abschließend sprachen sie über die verschiedenen Arten von Archiven und darüber, wie man das jeweils zuständige Archiv ermittelt – vom Stadt- oder Staatsarchiv bis hin zu kirchlichen oder militärischen Archiven. Schritt für Schritt lernen die Schülerinnen und Schüler so nicht nur die praktischen Methoden historischer Forschung kennen, sondern auch, wie man Historikerinnen und Historiker denken: fragend, verknüpfend und rekonstruktiv – um den Spuren der Vergangenheit neues Leben zu verleihen.
(12.11.2025; Khrystyna Maksymljuk)