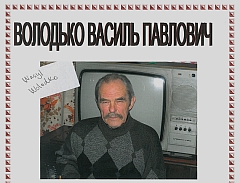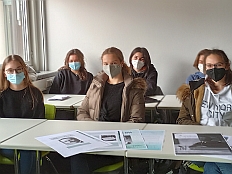9. Februar 2022
Interview mit Judith Einsiedel
Als katholische Seelsorgerin an der KZ-Gedenkstätte Dachau ist Judith Einsiedel Mitglied im Trägerkreis des Gedächtnisbuchs. Sie stellt sich in unserem Interview vor.

Darf ich Sie nach Ihren bisherigen beruflichen Stationen fragen?
Das hier ist, wenn man so will, meine dritte Stelle als Pastoralreferentin. Ich bin in Würzburg geboren, habe dort in der Nähe Abitur gemacht und war dann ein Jahr als Au-pair in Rom. Danach habe ich Lehramt Englisch und Latein studiert und als drittes Fach auch ein paar Semester Theologie. Meine Einsatzschulen während des Referendariats waren alle in München. In der Referendariatszeit habe ich dann gemerkt, dass es mich beruflich doch woanders hinzieht, dass die Schule auf Dauer doch nicht so mein Platz ist, und so habe ich als Zweitstudium die Theologie im Diplom gewählt.
Die Ausbildung zur Pastoralreferentin ist ja sehr umfassend, man macht viele praktische Kurse neben dem Studium, Exerzitien, geistliche Begleitung, Gesprächsführung, alles Mögliche. Danach wird man in verschiedenen Pfarreien eingesetzt. Ich war dann zwei Jahre im Pfarrverband Sendling und dann war ich nochmal zwei Jahre im Pfarrverband Mittersendling als Seelsorgerin.
Wie kommt es, dass Sie sich auf die Stelle als Seelsorgerin in der Gedenkstätte Dachau beworben haben?
Mein Interesse an der Thematik beginnt schon in Würzburg, wir hatten dort ja auch das Nagelkreuz, diese Versöhnungsinitiative mit Coventry. Ich habe in Würzburg ehrenamtlich in der Bahnhofsmission gearbeitet und wir hatten in der Bahnhofsmission ein Jahr lang das Wandernagelkreuz. Ich war auch einmal selbst in Coventry. Auch die Auseinandersetzung mit der Würzburger Stadtgeschichte spielt eine Rolle, die Zerstörung am 16. März 1945 und so weiter.
Dann bin ich einmal über einen Kirchentag auf Aktion Sühnezeichen gestoßen und war schließlich zweimal im Einsatz für Aktion Sühnezeichen, einmal im Landesbüro in Israel und dann in den USA, im dortigen Landesbüro in Philadelphia. Auch da habe ich gemerkt, wie mich das Thema, diese Friedens- und Versöhnungsarbeit doch immer innerlich bewegt hat. Ich habe gemerkt, das bedeutet mir etwas, ich kann mich damit identifizieren. Gerade in Israel durfte ich noch viele Shoah-Überlebende kennenlernen.
Während des Theologiestudiums, und das war sicher auch ein wichtiger Baustein, kam dann die Auseinandersetzung mit dem Judentum dazu. Für Theologiestudierende gibt es dieses Programm des DAAD in Jerusalem, an der Dormitio-Abtei, und da kann man für einige Monate als Theologiestudent, katholisch oder evangelisch, studieren. Und das habe ich gemacht. Dort hatten wir auch jüdische und muslimische Dozentinnen und Dozenten. Diese Begegnung mit dem heutigen Judentum und dem interreligiösen Dialog war sehr wichtig.
Und natürlich spielt auch das Interesse an Bildungsarbeit eine Rolle. Ich bin im Verein Freunde Abrahams e.V. Mitglied, da geht es ja um das Organisieren interreligiöser und religionsgeschichtlicher Veranstaltungen. Das ist auch etwas, was ich gerne mache. Aus alldem zusammen kam dann diese Bewerbung hervor.
Wissen Sie schon, wo Sie besondere Schwerpunkte als Seelsorgerin in Dachau setzen wollen?
Wenn ich so überlege – eigentlich bin ich noch gut damit beschäftigt, alle verschiedenen Bereiche kennenzulernen, alles zum ersten Mal zu machen. Jetzt gerade bin ich damit beschäftigt, das Programm für das erste Halbjahr 2022 abzuschließen, dann kommt der Befreiungstag, wir hatten im November den ersten ökumenischen Gottesdienst, dann geht es um die ersten Rundgänge, in denen ich Gruppen über das Gelände begleiten werde und noch vieles andere.
Natürlich, Dachau ist primär ein geschichtlicher historischer Ort, aber es gibt auch unsere religiösen Erinnerungsorte. Ich finde es sehr wichtig, dass dieser Aspekt des Seelsorgerischen und Theologischen auch eine Rolle spielt, vielleicht sogar erweitert werden kann, mit den evangelischen Kollegen zusammen, auch hin zur interreligiösen Dimension. So hat mir vor kurzem eine befreundete Muslima gesagt, sie würde gern mit muslimischen Jugendlichen aus der Moscheegmeinde die Gedenkstätte besuchen. Das muss man dann vielleicht anders angehen, als wenn eine durchschnittliche bayerische Schulklasse kommt. Diese weitergedachte interreligiöse Komponente wäre mir schon eine Freude.
Was ist für Sie das Besondere am Gedächtnisbuch?
Am eindrücklichsten war für mich das Engagement junger Menschen, das hat mir die Präsentation des Gedächtnisbuchs im Oktober gezeigt. Die Schülerinnen und Schüler haben sich ja in das Thema sehr vertieft, Kontakte geknüpft mit den Angehörigen, sie waren so richtig mit Kopf und Herz dabei. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene als der Geschichtsunterricht. Und auch ganz grundsätzlich wird dieses biografische Arbeiten immer wichtiger, da es ja immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt.
Was wünschen Sie dem Gedächtnisbuch?
Geld natürlich, das heißt eine gesicherte Finanzierung. Es wäre schön, wenn die jetzige Arbeit gesichert wäre. Und man könnte mit mehr Ressourcen alles auch ein Stück weit ausbauen, mehr Menschen die Mitarbeit ermöglichen, mehr im internationalen Bereich tätig werden.
(9.2.22; IS)