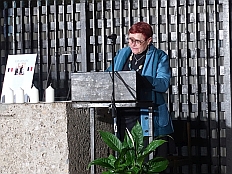Jahrespräsentation: Zwölf neue Biographien
Ein Dutzend neuer Lebensgeschichten von im KZ Dachau inhaftierten Menschen stellten die Autorinnen und Autoren des Gedächtnisbuchs bei der Jahrespräsention am 22. März 2025 vor. Am Ende der Präsentation standen die jüngsten Mitwirkenden vor dem Mikro, Schüler*innen aus Stephanskirchen mit der Lehrerin Michaela Hoff.
Sie stellten den Sinto-Musiker Frank Gory Kaufmann vor, der die NS-Verfolgung, u.a. in den Konzentrationslagern Dachau und Sachsenhausen, überlebte. Der Musiker starb 1992 in Sindelfingen. Das Gedächtnisbuch konnte ein von Kaufmann selbst verfasstes und gespieltes Stück vom Datenträger präsentieren.
Eugen Bühler: Flucht nach Novemberpogrom und KZ-Haft
Vieles, was Andrea Kugler vom Stadtmuseum Nördlingen, über Eugen Bühler berichten konnte, hat sie von dessen Tochter erfahren. Suse Broyde, 1936 in Nördlingen geboren, forscht heute noch an der New York University. Die Tochter Bühlers erzählte der Gedächtnisbuchautorin von der Folter, die ihr Vater während des KZ-Aufenthalts in Dachau erleiden musste, und auch von der tiefen Bindung an die Heimatstadt Nördlingen. Eugen Bühler litt bis zu seinem Lebensende an psychischen und physischen Problemen, Folgen des Traumas der Verfolgungszeit. Er lebte bis 1970 in New York.
Konrad Just: „Der Autorität ist nur zu gehorchen, als sie nichts Sündhaftes befiehlt“
Über das Leben seines Ordensbruders Konrad Just berichtete Reinhold Dessl, der Abt des Zisterzienserstiftes Wilhering in Oberösterreich. Just hatte schon in den 30er Jahren als Kaplan gegen den Nationalsozialismus gepredigt. In einem seiner Manuskripte aus dem Jahr 1934 steht: „Der Autorität ist nur soweit zu gehorchen, als sie nichts Sündhaftes befiehlt.“ Er wurde bereits am Tag des Einmarsches der Nationalsozialisten in Österreich am 12. März 1938 verhaftet und bis zu seiner Befreiung auf dem Todesmarsch am 30. April 1945 in den Lagern Dachau und Buchenwald gefangengehalten. Die Heimkehr nach Gramastetten in Österreich brachte eine Enttäuschung: „Man hat nicht den Eindruck, dass man die volle Gefahr des Hitlerismus erkannt hat.“, schrieb Konrad Just nach dem Krieg.
Jean Lafaurie: Für jene sprechen, die niemals zurückgekehrt sind
Noémie Hernandez, ASF-Freiwillige im Gedächtnisbuch, interviewte für ihre Biografie den 101-jährigen Jean Lafaurie in Paris – ein Ausschnitt dieses Gesprächs war Teil ihrer Präsentation. Lafaurie hatte sich als sehr junger Mann der Résistance im Südwesten Frankreichs angeschlossen, wurde verraten und nach Dachau deportiert. Hier musste er im Außenlager München-Allach für BMW arbeiten. Wieder zurück in Frankreich schweigt er über seine Erlebnisse in den deutschen Konzentrationslagern, denn „niemand will glauben, was er erlebt hat“. Erst viel später wird es für ihn zur Lebensaufgabe, seine Geschichte zu erzählen, berichtet Noémie Hernandez.
Max Fried: Die Wahlheimat München entwickelt sich zum antisemitischen Hexenkessel
Der Architekt und Privatlehrer Max Fried zog im Jahr 1900 zum Studium nach München und wohnte fortan in der Stadt. Referentin Irene Stuiber aus dem Team des Gedächtnisbuchs schilderte, dass dem Sohn Max Frieds die Emigration gelang – es ihm aber nicht mehr möglich war, seine Eltern nach Bolivien nachzuholen. 1943 wurde das Ehepaar Lilly und Max Fried nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. 1954 erfolgte die Todeserklärung.
Eugen Zelený: Wichtig waren ihm seine internationalen Kontakte
Der tschechische Pfarrer Eugen Zelený stand im Mittelpunkt von Bettina Korbs Präsentation. Zelený hatte, unbemerkt von den deutschen Besatzern, jüdische Kinder vor der Verfolgung gerettet. Verhaftet wurde er wegen seiner Predigten und musste fast 4 Jahre KZ-Haft in Dachau erleiden. Nach dem Krieg war er bis zu deren Verstaatlichung Direktor der Diakonie der Böhmischen Brüder in Tschechien. Er reiste als Vertreter der tschechischen KZ-Häftlinge und Christen 1967 zur Eröffnung der Evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte.
August Hölzel: „Wir Enkelkinder konnten unseren Opa nie kennenlernen“
Die Lebensgeschichte ihres Großvaters August Hölzel stellte Rita Willnat vor. August Hölzel war ein sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär in Wiesbaden, der sich auch in anderen sozialdemokratischen Verbänden und in der Kommunalpolitik vielfältig engagierte. Nach der Machtübernahme der Nazis verlor er seine Arbeit und seine Ehrenämter. Noch im September 1944 wurde er im Rahmen der Verhaftungswelle „Aktion Gewitter“ ins KZ Dachau gebracht. August Hölzel überlebte die KZ-Haft nicht. Rita Willnat berichtete, dass die Geschehnisse ihre Kindheit prägten: „Meine Großmutter redete ständig vom Krieg und dem schrecklichen Leid, das er Millionen von Menschen brachte.“
Heinz Pappenheimer: Schwierige Eingewöhnung in Palästina
Heinz Pappenheimer, dessen Biografie Werner Dombacher in den Mittelpunkt seines Gedächtnisblatts gestellt hat, gehörte zu jenen Häftlingen im KZ-Dachau, die nach dem Novemberpogrom 1938 als sogenannte „Aktionsjuden“ inhaftiert wurden. Am 5. Januar 1939 wurde er entlassen, ihm und seiner Familie gelang die Emigration in das damalige Palästina. Seit Juli 2019 gibt es in Aalen vier Stolpersteine zum Gedenken an die Familie Pappenheimer.
Heinrich Staub: NS-kritische Haltung
Durch regimekritische Bemerkungen fiel Heinrich Staub der Polizei an seinem Heimatort Dreieich-Sprendlingen auf. „Am 16. Mai 1944 wurde er zur Polizeibehörde ins Rathaus zitiert und kehrte nicht mehr zurück“, so heißt es im Vortrag seiner Enkelin Gudrun Czerwinski. Leider konnte die Verfasserin des Gedächtnisblatts aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Präsentation kommen. Marine, Freiwillige von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, übernahm es, den Text vorzutragen. Staub musste im KZ Dachau den roten Winkel für politische Gefangene tragen und starb am 1. Februar 1945 im Konzentrationslager.
Georgij Solomonoff: Vieles bleibt unklar

Houman Amjadi recherchierte die Biografie von Georgij Solomonoff, der nach den im Archiv der Gedenkstätte befindlichen Unterlagen einer von zwei iranischen Häftlingen im KZ Dachau gewesen sein soll. Trotz intensiver Nachforschungen ließ sich weder das Geheimnis der Staatsangehörigkeit des im heutigen Petersburg geborenen Mannes klären, noch der Grund seiner dreimonatigen Verhaftung im August 1944. „In den Wirren des Krieges sind leider sehr viele Unterlagen vernichtet worden“, so der Vortragende. Solomonoffs letzter Wohnort war Kalifornien, hier starb er 2017.
Josef Finster: Ein kurzes Leben, ein langer Weg zur Erinnerung
Vorstrafen wegen geringfügiger Delikte in wirtschaftlich und sozial schwierigen Zeiten, der falsche Wohnort, ohne feste Arbeitsstelle – dies reichte, um von den Nazis als „Berufsverbrecher“ in sogenannte Sicherheitsverwahrung genommen zu werden. Waltraud Finster berichtet über ihren Großonkel Josef Finster, dem dies geschah. Der Linzer wurde nach dem Anschluss Österreichs am 14. Juni 1938 verhaftet, am 17. Juni nach Dachau überstellt, am 1. Juli in das KZ Flossenbürg eingeliefert. „Mein Großonkel ist 162 cm groß und von schmächtiger Statur. Die Arbeit im Steinbruch kann er nicht überleben.“, berichtet Waltraud Finster. „Die Geschichte von Josef Finster muss erinnert werden, weil er für eine soziale Gruppe von Opfern des Nationalsozialismus steht, die bislang keine Aufmerksamkeit und keine Anerkennung erfahren haben.“
Kazimierz Wawrzyniak: Er hatte viele Freunde in der ganzen Welt

Als junger Novize des Ordens der Steyler Missionare wurde Kazimierz Wawrzyniak im polnischen Chludowo von den deutschen Besatzern verhaftet und am 24. Mai 1940 in das KZ Dachau eingeliefert. Wiederholte TBC-Erkrankungen kennzeichneten seinen Lageraufenthalt, er musste als Versuchsperson medizinischer Versuche herhalten und wurde OPs unterzogen, die zur lebenslangen Invalidität führten. Anna Hayward, jetzt Schwester Stefania im Karmel Dachau, berichtete, dass er im Lager seinen Glauben verlor und erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt wieder zur Religion fand. Kazimierz Wawrzyniak war nach dem Krieg Journalist, Wirtschaftswissenschaftler, Germanist, Diplomat und Handelsberater der polnischen Botschaft. „Er hatte viele Freunde in der ganzen Welt, größtenteils ehemalige Mithäftlinge.“, konnte Schwester Stefania mitteilen.
Für eine lebens- und liebenswerte Gesellschaft
Sabine Gerhardus, Projektleiterin des Gedächtnisbuchs, bedankte sich bei den Mitwirkenden: „Sie alle, die Sie die Geschichte in Erinnerung halten, zuhören und hinschauen, Sie helfen mit, unsere Gesellschaft lebens- und liebenswert zu halten. Dafür danke ich Ihnen von Herzen.“
Für den Trägerkreis des Gedächtnisbuchs begrüßte Björn Mensing die Teilnehmenden. Frank Schleicher übernahm die Verabschiedung.
Tim Turusov ist für die sehr gelungene musikalische Umrahmung der Veranstaltung zu danken.
(3.4.25; IS)