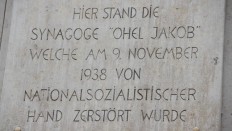W-Seminar Grafing: Gestaltungsworkshop mit Bruno Schachtner
29.7.2015 im Max Mannheimer Studienzentrum in Dachau. Kurz vor den Sommerferien trafen sich hier die Schüler des W-Seminars Grafing und ihrer Lehrerin Petra Köpf mit dem Dachauer Künstler und Grafiker Bruno Schachtner. Ein Schuljahr voller Arbeit, Theorie und Suche in Archiven liegt hinter ihnen.

Noch bevor die Texte für die Gedächtnisblätter fertig geschrieben werden, dürfen die Schüler sich mit ihrer Biographie von einer ganz anderen Seite her befassen: Wie soll mein Gedächtnisblatt aussehen? Wie gestalte ich die Lebensgeschichte so, dass sie Interesse weckt, Leser anzieht?
Profi-Tipps des Grafikers wurden gleich in Skizzen, Entwürfe, Zeichnungen umgesetzt. Alle wollen nun aufpassen, dass das Verhältnis von Text und Bild stimmt, dass man das Gedächtnisblatt „nicht zu voll macht“, nicht zu viel auf eine Seite packt und Acht geben, dass es den Leser interessiert.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse für Melanie war, dass es von der Gestaltung her etwas Durchgehendes geben kann, das alle vier Gedächtnisbuch-Seiten miteinander verbindet. Alicia fand die Einteilung des Textes in Spalten wichtig und hat schon eine Idee für die zeichnerische Gestaltung der Frontseite. Lena ist klar geworden, dass ein Thema ihrer Biographie (Auswanderung) nicht nur einer unter vielen Punkten ist, sondern dass es ein Schwerpunkt im Gedächtnisblatt werden soll. Sie hat dazu jetzt auch eine ganz konkrete kreative Idee entwickelt. Jonathan meint, wenn man bastelt, was in der Hand hält, dann weiß man plötzlich besser, worauf es ankommt – selbst wenn man eigentlich im Computer gestalten will – „da sieht man ganz anders drauf“. Eva drückt aus, was auch die anderen denken: „Endlich hat man hat ein Bild vor Augen, wie man das Gedächtnisblatt gestalten will!“ Dankeschön an Bruno Schachtner!
Und noch ein herzliches Danke geht an den BLLV, der das Mittagessen bezahlte!
Text und Bilder: Sabine Gerhardus