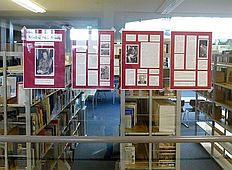Musik verschiedener Kulturen zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz
Kristina Eremina, Freiwillige von Aktion Sühnezeichen im Gedächtnisbuchprojekt, sang bei einem Konzert anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz. Hier ihr Bericht.
Am 1. Februar 2020 fand ein Konzert zur Erinnerung an die Befreiung von Ausschwitz im Altarraum der Kirche Peter und Paul in Pfedelbach statt. Grausame Bilder aus Auschwitz, aufgenommen in den Tagen nach der Befreiung des Vernichtungslagers in Polen am 27. Januar 1945, sind im Altarraum der Pfedelbacher Kirche Peter und Paul zu sehen. Abgequälte, ausgemergelte Häftlinge, Leichenberge und die durch das Eingangstor von Auschwitz-Birkenau führenden Eisenbahnschienen wurden zum Symbol des im KZ herrschenden Grauens. Alle diese schrecklichen Szenen haben die sowjetischen Streitkräfte mit der Kamera dokumentiert.
Das Evangelische Jugendwerk Öhringen (EJÖ), das dieses Konzert veranstaltete, wollte damit nicht nur das Andenken an die Opfer gestalten, sondern auch „Frieden in die Welt“ bringen mit Musik aus unterschiedlichen Kulturen. Ich wurde vom Jugendreferenten des EJÖ, Daniel Febel, eingeladen, den Gästen des Abends ein russisches Musikstück darzubieten. Mit Igor Botschkow, einem Freiwillige aus der Jugendbildungsstätte Unterfranken in Würzburg, der mich mit der Gitarre begleitete, bin ich dorthin gefahren.
Ein aus Teelichtern bestehendes Friedenszeichen wird am Anfang der Veranstaltung in der Pfedelbacher Kirche Peter und Paul entzündet. Schöne Musik bringt alle Mitwirkenden des Friedenskonzertes in das Gotteshaus. Stimmen aller Welt verschmelzen im Einklang. Reine Lebensfreude bringt die brasilianische musikalische „Familia“ nach Pfedelbach. Dagegen klingt das Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“ nachdenklich. Durch ein türkisches Lied aus dem 15. Jahrhundert fühlen sich Veranstaltungsbesucher in die Vergangenheit versetzt. Englische Lieder und melancholische Weisen aus Rumänien werden zwischen den Wortbeiträgen zum Gedenken vorgetragen. „Ihr seid nicht dafür verantwortlich, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“, erklingt die Stimme der EJÖ-Mitarbeiterin Elisa Kober, die an Max Mannheimers Worte erinnert. Lebenslust spricht aus den iranischen mit der Gitarre gespielten Popsongs und einem Musikstück auf Russisch, das einer der ehemaligen Freiwilligen aus der Ukraine geschrieben hat. Ich trete mit Igor mit dem Lied „Kukuschka“ (Kuckuck) der russischen Musikband „Kino“ auf, das Ende der 1990er Jahre von Viktor Zoji geschrieben worden ist. Mit dem gemeinsamen Singen des Lieds von Reinhard Mey „Über den Wolken“ findet die abendliche Musikveranstaltung ein harmonisches Ende.
Der musikalische Erinnerungsabend bleibt wird lange in unseren Herzen bleiben. Zusammen mit Daniel bereitete ich außerdem einen musikalischen Beitrag für die Präsentation der neuen Gedächtnisblätter am 22. März in der Kirche des Karmel Heilig Blut in Dachau vor. Das Team aus Öhringen und Schüler des Max Mannheimer Gymnasiums Grafing werden das Programm ebenfalls musikalisch begleiten. Mit Ungeduld warten wir auf das nächste Treffen mit den Musikern aus Öhringen und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Präsentation der neuen Biografien des Gedächtnisbuchs am 22. März 2020.
(10.2.2020; Text: Kristina Eremina/IS)